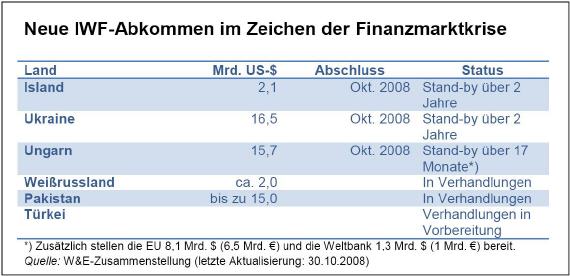Die Klima-Heuchelei der reichen Welt
Ein Kommentar von Jayati Gosh
Viele Menschen auf der ganzen Welt betrachten die Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow (COP26) bereits als Enttäuschung. Das ist wohl eine krasse Untertreibung. Weltweit – aber insbesondere in der entwickelten Welt – begreifen Spitzenpolitiker nicht, wie enorm die Herausforderung durch den Klimawandel ist. Obwohl sie dessen Dringlichkeit und den Ernst der Lage in ihren Reden anerkennen, verfolgen sie zumeist kurzfristige nationale Interessen und geben komfortabel weit in der Zukunft einzulösende „Netto-Null-Versprechungen” ab, ohne klare und zeitnahe Verpflichtungen für unmittelbares Handeln einzugehen.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Erklärungen zahlreicher Staats- und Regierungschefs reicher Länder in Glasgow im Widerspruch sowohl zu ihren tatsächlichen Klimastrategien als auch zu Aussagen stehen, die sie in anderen Kontexten abgeben. Während etwa die politischen Spitzen der G7 am Gipfel wenig berauschende grüne Zusagen für einen mehrere Jahrzehnte in der Zukunft liegenden Zeitraum abgaben, waren sie gleich zur Stelle, als es darum ging, noch mehr Investitionen in fossile Brennstoffe zu erlauben und zu ermöglichen, die mittelfristig zu zusätzlicher Produktion und Treibhausgasemissionen führen werden.
Könnte beispielsweise einmal die tatsächliche US-Regierung aufstehen und sich erklären? Im Rahmen seiner jüngsten Rede in Glasgow sagte etwa Präsident Joe Biden, dass „wir die derzeitigen Schwankungen bei den Energiepreisen nicht als Grund für eine Rücknahme unserer Ziele im Bereich sauberer Energien betrachten sollten, sondern als Handlungsaufforderung“. Tatsächlich, so Biden, „bekräftigen die hohen Energiepreise nur die dringende Notwendigkeit, Energiequellen zu diversifizieren, den Einsatz sauberer Energien zu erhöhen und vielversprechende neue Technologien im Bereich saubere Energieträger zu adaptieren.“
Nur drei Tage später behauptete die Biden-Administration jedoch, die OPEC+ würden den globalen Wirtschaftsaufschwung gefährden, weil man die Ölproduktion nicht anhebe. Die Administration warnte sogar, dass die Vereinigten Staaten bereit wären, „alle notwendigen Mittel” einzusetzen, um die Kraftstoffpreise zu senken. Dabei handelt es sich um das eklatanteste Beispiel von Klima-Heuchelei eines führenden Industrielandes der letzten Zeit...
... den kompletten Kommentar finden Sie >>> hier.
mehr...
Regierungen müssen in Glasgow in den Krisenmodus
Die schwachen Klimaschutzziele der Länder, die unzureichende finanzielle Unterstützung für wirtschaftlich benachteiligte Länder und der Umgang mit Schäden, die der Klimawandel verursacht: Das sind die drei großen Baustellen der Weltklimakonferenz (COP26), die heute in Glasgow beginnt.
Ein Gastkommentar von Jan Kowalzig*)
In Glasgow müssen die Regierungen sofort in den Krisenmodus gehen. Die krasse Unzulänglichkeit der eingereichten Klimaschutzziele der Länder unter dem Pariser Abkommen droht den Planeten zu verbrennen. Kurz vor der COP26 hatte das UNFCCC-Klimasekretariat in einer Analyse dieser Selbstverpflichtungen unter dem Pariser Abkommen davor gewarnt, dass die globalen Emissionen bis 2030 um 16% ansteigen werden. Um die globale Erwärmung auf maximal 1,5°C zu begrenzen, wie es das Pariser Abkommen vorsieht, müssten sie aber um knapp die Hälfte sinken.
Die Welt steuert auf eine katastrophale Entwicklung der Klimakrise zu. Die Regierungen müssen auf der COP26 beschließen, ihre mittel- und langfristigen Pläne nicht erst – wie eigentlich vorgesehen – in fünf Jahren, sondern so lange jedes Jahr nachzubessern, bis deren Gesamtwirkung es ermöglicht, die globale Erwärmung auf 1,5°C zu begrenzen.
* Mehr Mittel für die Anpassung an die Klimakrise
Die zweite große Baustelle der Weltklimakonferenz sind die finanziellen Klima-Hilfen der Industrieländer für von der Klimakrise betroffene, wirtschaftlich benachteiligte Länder. Das Versprechen der Industrieländer, diese Hilfen bis 2020 auf jährlich 100 Mrd. US-Dollar anzuheben, wurde nicht gehalten. Die Geberländer hatten dazu am Montag einen Plan vorgelegt, nach dem sie das Ziel nun 2023 erreichen würden – drei Jahre später als versprochen.
Die Klimafinanzierung ist ein wichtiger Baustein in der mühselig austarierten Balance des Vertrauens zwischen den Ländern. Dass das Versprechen der Industrieländer nicht eingehalten wurde, ist eine schwere Hypothek, die nun auf der COP26 lastet. Nicht nur erhalten die betroffenen Länder deutlich weniger Unterstützung als zugesagt; auch handelt es sich großenteils um Kredite, die die Schuldenkrise verschärfen. Zudem wird nach wie vor nur rund ein Viertel der Gelder für die Anpassung an den Klimawandel verwendet, etwa zum Schutz der Ernten vor Dürren oder Überschwemmungen. Die Industrieländer sollten auf der COP26 zusagen, bis 2025 den Anteil der Mittel für Anpassung auf 50% der Klimafinanzierung anzuheben.
* Unterstützung bei Schäden und Verlusten
Ein drittes großes Thema für die besonders vom Klimawandel betroffenen oder bedrohten Länder ist der Umgang mit Schäden und Verlusten, die sich auch trotz umfangreicher Anpassungsmaßnahmen nicht vermeiden lassen, etwa wenn flache Küstenstreifen nach und nach im Meer versinken oder der Anbau von Nahrungsmitteln wegen wiederkehrender Dürren zunehmend unmöglich wird. Die COP26 wird über das Thema verhandeln, sich dabei aber um eher technische und prozedurale Fragen kümmern. Die Notwendigkeit neuer finanzieller Unterstützung möchten die Industrieländer wie bisher auch auf dieser Konferenz möglichst ausklammern, weil sie Kompensationsforderungen betroffener Länder für angerichtete Schäden fürchten.
Die betroffenen Länder brauchen dringend mehr Unterstützung nicht nur für die Anpassung an die Veränderungen, sondern auch für den Ausgleich von unvermeidlichen Schäden und Verlusten. Das ist auch eine Frage der globalen Gerechtigkeit, denn diese Länder haben oft kaum oder gar nicht zur Klimakrise beigetragen. Auf der COP26 sollten die Regierungen dringend vereinbaren, in den kommenden Jahren neue Gelder zu mobilisieren und geeignete Mechanismen zu ihrer Verteilung einzurichten.
Jan Kowalzig ist Referent bei Oxfam Deutschland für Klimawandel und Klimapolitik.
Hinweis:
* Rainer Falk: Eine Strategie des Südens für Glasgow. Entwicklungsorientierung und Anpassung an den Klimawandel, auf: weltwirtschaft-und-entwicklung.org
mehr...
G20-Gipfel an der Weggabelung in Rom
Verbesserter Zugang zu COVID-19-Impfstoffen, gerechte Teilhabe am wirtschaftlichen Aufschwung, Senkung gefährlicher Treibhausgasemissionen und Unterstützung einkommensschwacher Länder bei der Anpassung an die Klimakrise: Das etwa sind die Kernforderungen der Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam für dem G20-Gipfelan diesem Wochenende in Rom. Die skandalöse Ungleichheit beim Zugang zu Covid-19-Impfstoffen zu beenden, ist die wichtigste Aufgabe der Staats- und Regierungschef*innen auf dem G20-Gipfel. Ursprünglich hatten die wohlhabenden Länder versprochen, dass jeder erfolgreiche Impfstoff „ein globales öffentliches Gut" sein würde; Ländern mit niedrigerem Pro-Kopf-Einkommen sagten sie 1,8 Mrd. Impfdosen zu. Ein Jahr später sind davon gerade einmal 261 Mio. (14%) bereitgestellt. Während die Impfquoten in wohlhabenden Ländern teilweise bei über 70% liegen, sind in den ärmsten Teilen der Welt kaum 2% mit mindestens einer Dosis geimpft.
Die dramatische Lage erlaubt kein „Weiter so“, sondern braucht mutige Entscheidungen für Impfgerechtigkeit. Ein konkreter Vorschlag liegt bereits auf dem Tisch: Indien und Südafrika fordern gemeinsam mit über 100 weiteren Ländern die Aussetzung des Patentschutzes für Covid-19-Impfstoffe, um die Produktion zu steigern und die Kosten für alle zu senken. Stattdessen haben sich die wohlhabenden Länder den Löwenanteil der Impfdosen gesichert und verteidigen die Monopolinteressen von Pharmaunternehmen.
Die G20 müssen auch dazu beitragen, die wirtschaftliche Erholung nach der Coronakrise gerechter zu gestalten und insbesondere das weltweite Hungerproblem anzugehen. Mehr als 40 Millionen Menschen leiden unter extremem Hunger, wesentlich verursacht durch die wirtschaftlichen Schocks im Zuge der Pandemie. Weltweit sind die Nahrungsmittelpreise um rund 40% gestiegen, der höchste Anstieg seit über einem Jahrzehnt. Die gesellschaftlichen Ressourcen zur Bewältigung dieser historischen Krise sind allerdings höchst ungleich verteilt: Während die industrialisierten Volkswirtschaften im Jahr 2020 durchschnittlich rund 20%t ihres Bruttonationaleinkommens für die Unterstützung ihrer Bevölkerung ausgaben, waren es in Schwellenländer und der Länder mit niedrigem Einkommen nur zwischen 2 und 5%.
Schließlich bedroht die Klimakrise die Existenzgrundlage von Millionen Menschen. Von den verheerenden Auswirkungen extremer Wetterereignisse, steigender Temperaturen und des Anstiegs des Meeresspiegels sind weltweit am stärksten Menschen betroffen, die in Armut leben und am wenigsten zur Erderwärmung beigetragen haben. Oxfam und andere NGOs fordern die G20-Staats- und Regierungschefs in Rom dazu auf, ihre Klimaschutzmaßnahmen zu verstärken, indem sie ehrgeizige nationale Ziele zur Emissionsreduzierung vorlegen, die ihrem fairen Anteil entsprechen, und ihre Zusagen für die Klimafinanzierung erhöhen.
Außer Acht bleiben dürfen aber auch nicht andere Bereiche. Die Arbeit an dem soeben vereinbarten Steuerreformpaket ist fortzusetzen, um Steuergerechtigkeit herzustellen und gegen die Gewinnverschiebung von Unternehmen sowie die schädlichen Auswirkungen des Steuerwettbewerbs wirksamer vorzugehen. Darüber hinaus muss in universelle Systeme für Bildung, Gesundheit und soziale Sicherung investiert werden, um Gesundheits-, Klima- und Wirtschaftsschocks und ihre Folgen zu bewältigen.
Alles dies sind keine leicht zu verwirklichen Forderungen. Aber sie charakterisieren, dass die G20 jetzt endgültig am Wendepunkt angekommen sind. Ohne sie in Angriff zu nehmen, werden die G20 an der Wegegabelung in Rom falsch abbiegen und die Chance auf eine neue Form der Global Governance wieder einmal verpassen.
mehr...
Putschversuch beim IWF
Gastkommentar von Joseph E. Stiglitz
Es sind derzeit Bemühungen im Gange, Kristalina Georgieva, die seit 2019 amtierende Geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, abzulösen oder zumindest stark zu schwächen. Dieselbe Georgieva wohlbemerkt, deren herausragende Reaktion auf die Pandemie rasch für Mittel sorgte, um die betroffenen Länder über Wasser zu halten und der Gesundheitskrise zu begegnen, und die sich erfolgreich für die Ausgabe von Sonderziehungsrechten (SZR; die Währung des IWF) im Volumen von 650 Milliarden Dollar eingesetzt hatte, die für die Erholung von Ländern niedrigen und mittleren Einkommens so wichtig sind. Darüber hinaus hat Georgieva den Fonds so aufgestellt, dass er eine globale Führungsrolle bei der Reaktion auf die existenzielle Krise des Klimawandels übernehmen kann.
Wo also liegt das Problem? Und wer steht hinter den Bemühungen, sie zu diskreditieren und loszuwerden? Das Problem ist ein Bericht, den die Weltbank bei der Anwaltskanzlei WilmerHale in Auftrag gegeben hat und der den jährlichen Doing Business-Index der Bank betrifft, in dem Länder danach eingestuft werden, wie leicht sich dort Wirtschaftsunternehmen gründen und betreiben lassen. Der Bericht enthält Vorwürfe – oder präziser, „Andeutungen“ – über Unregelmäßigkeiten in den Indizes der Jahre 2018 und 2020 in Bezug auf China, Saudi-Arabien und Aserbaidschan. Georgieva wurde für den Index 2018 angegriffen, in dem China auf Rang 78 eingestuft wurde (demselben Platz wie im Vorjahr). Doch wird angedeutet, dass China niedriger hätte eingestuft werden sollen und dass dies im Rahmen einer Einigung über die Unterstützung Chinas für eine Kapitalerhöhung unterblieb, um die sich die Bank damals bemühte. Georgieva war damals Chief Executive Officer der Weltbank. Das einzig positive Ergebnis dieser Episode könnte die Abschaffung des Index sein. Schon vor einem Vierteljahrhundert, als ich Chefökonom der Weltbank war und Doing Business von einer separaten Sparte der Bank, der Internationalen Finanz-Corporation, veröffentlicht wurde, hielt ich Doing Business für ein schreckliches Produkt. Länder erhielten gute Bewertungen für niedrige Körperschaftsteuern und schwache Arbeitsmarktregeln. Die Zahlen waren stets wenig belastbar, wobei kleine Änderungen bei den Daten potenziell große Auswirkungen auf die Rankings haben konnten. Länder waren unweigerlich empört, wenn scheinbar willkürliche Entscheidungen sie in im Ranking abrutschen ließen...
... den vollständigen Kommentar finden Sie >>> hier.
mehr...
Kartographie der Unterdrückung und der Migration: Mark Bradfords 'Masses and Movements' in Menorca
Wie oft waren wir an den Gestaden der Balearen. Und wie oft hat sich unsere Faszination von der Schönheit und Natur dieser Region in Traurigkeit und kalte Wut verwandelt angesichts der ungezählten Migrant*innen, die Tag für Tag im Mittelmeer ertrinken. Der amerikanische Weltklasse-Künstler Mark Bradford hat jetzt den Versuch unternommen, die Kartographie der globalen Unterdrückung und Migration zu entschlüsseln. Als Standort der Ausstellung ‚Masses and Movements‘ fungiert nicht zufällig Menorca. Von Rainer Falk.
Mark Bradfords Ausstellung, die noch bis 31. Oktober läuft, ist die Eröffnungsschau der neuesten Galerie von Hauser & Wirth auf der kleinen ‚Isla del Rey‘ im Hafen von Mahon in Menorca. In seiner ersten Ausstellung in Spanien präsentiert der Künstler eine Installation skulpturaler Globen, ein In-Situ-Wall Painting und eine Serie neuer Leinwände, die auf einer Weltkarte aus dem 16. Jahrhundert basiert und auf der zum ersten Mal der Name ‚America‘ gedruckt erscheint.
● Erkenntnispotential der Abstraktion
‚Masses and Movements‘ füllt sieben Galerieräume. Integraler Bestandteil ist ein neues soziales Projektengagement Bradfords, mit dem er künstlerische Bildung einwandernden Gemeinschaften nahebringen will, und eine Schau, die die globale Immigrationskrise beleuchtet. In Fortsetzung seiner karrierelangen Erforschung von Systemen, die marginalisierte Bevölkerungen unterdrücken, zeigt Bradfords neueste Ausstellung Werke, die reich an formaler und allegorischer Komplexität sind und die Bedeutung der Abstraktion für das Verständnis der Welt, in der wir leben, unterstreichen; und nebenbei auch seinen Platz unter der wichtigsten heute lebenden Künstlern...
... den vollständigen Artikel lesen Sie >>> hier.
mehr...
Bundesbank blockiert Umverteilung von Sonderziehungsrechten
Heute erfolgt die Neuzuteilung der Sonderziehungsrechte (SZR) in Höhe von 650 Mrd. US-Dollar, die der IWF am 2. August beschlossen hat (>>> Neuer IWF-Geldsegen für wen?). Es ist die größte Ausschüttung in der Geschichte des IWF. Damit soll die globale Erholung vor allem in Niedrig- und Mitteleinkommensländern unterstützt werden. Deutschland erhält rund 36 Mrd. US-Dollar, deutlich mehr als alle Niedrigeinkommensländer zusammen. Ähnlich ungleich ist die Zuteilung für andere große Industrieländer. Daher forderte der IWF seine reichen Mitglieder auf, die Mittel an die ärmeren Länder umzuverteilen. Doch die Bundesbank, die für die Verwaltung der deutschen Währungsreserven zuständig ist, sperrt sich gegen die Umverteilung.
Wie Malina Stutz, politische Referentin von erlassjahr.desagt, gibt es „kein Gesetz, dass der Bundesbank die Weitergabe der Sonderziehungsrechte ausdrücklich verbietet. Reiche Länder wie Deutschland, die sich Liquidität zum Nulltarif am Kapitalmarkt beschaffen können, müssen dafür sorgen, dass ihre Zuteilungen an ihr eigentliches Ziel gebracht werden, also einkommensschwächere und von Covid-19 besonders betroffene Länder.“
Zudem muss vermieden werden, dass durch die Ausweitung der globalen Liquidität eigentlich überschuldete Länder kurzfristig weiter zahlungsfähig gehalten werden und somit eine nachhaltige Lösung für die globale Schuldenkrise weiter hinausgezögert wird. 2021 werden in Entwicklungs- und Schwellenländern Schuldendienstverpflichtungen von mehr als 350 Milliarden US-Dollar fällig, 2022 noch einmal fast genauso viel. Stutz dazu: „Damit die Finanzspritze auch wirklich ihren Zweck erfüllt anstatt erneut lediglich den Bailout privater Gläubiger zu finanzieren, darf sie nicht als Alternative zu echten Schuldenerleichterungen betrachtet werden. Diese müssen gleichzeitig allen überschuldeten Ländern ermöglicht werden.“
Bodo Ellmers vom Global Policy Forum Europe fügt hinzu: „Es ist völlig inakzeptabel, dass die Bundesbank das 30-Milliarden-Euro-Geschenk vom IWF einfach ungenutzt auf ihren Konten schlummern lassen will. Die Hälfte des deutschen Anteils würde ausreichen, um die Finanzierungslücke der UN-Programme für Covid-Impfungen und Tests in Entwicklungsländern für dieses Jahr vollständig zu füllen. Diese Mittel mitten in der Krise nicht einzusetzen heißt, Leben aufs Spiel zu setzen.“
mehr...
Die Blutspur des US-Interventionismus
Gastkommentar von Jeffrey D. Sachs
Die Dimension des Versagens der Vereinigten Staaten in Afghanistan ist atemberaubend. Dabei handelt es sich nicht um ein Versagen von Demokraten oder Republikanern, sondern um ein dauerhaftes Versagen der amerikanischen politischen Kultur, das sich im mangelnden Interesse der US-Politik äußert, andere Gesellschaften zu verstehen. Und das ist nur allzu typisch.
Nahezu jede US-Militärintervention der letzten Jahrzehnte in Entwicklungsländern hat sich als Fehlschlag erwiesen. Seit dem Koreakrieg lassen sich nur schwer Ausnahmen finden. In den 1960er Jahren und in der ersten Hälfte der 1970er Jahre kämpften die USA in Indochina - Vietnam, Laos und Kambodscha – und zogen nach einem Jahrzehnt grotesken Blutzolls schließlich geschlagen ab. Präsident Lyndon B. Johnson, ein Demokrat, und sein Nachfolger, der Republikaner Richard Nixon, tragen gemeinsam die Schuld dafür.
Etwa zur gleichen Zeit setzten die USA in ganz Lateinamerika und Teilen Afrikas Diktatoren ein - mit katastrophalen, jahrzehntelangen Folgen. Man denke an die Mobutu-Diktatur in der Demokratischen Republik Kongo nach der von der CIA unterstützten Ermordung Patrice Lumumbas Anfang 1961 oder an die mörderische Militärjunta von General Augusto Pinochet in Chile nach dem von den USA unterstützten Sturz Salvador Allendes im Jahr 1973.In den 1980er Jahren suchten die USA unter Ronald Reagan Mittelamerika in Stellvertreterkriegen heim, um linke Regierungen zu verhindern oder zu stürzen. Davon hat sich die Region bis heute nicht erholt.
Seit 1979 haben vor allem der Nahe und Mittlere Osten sowie Westasien die Torheit und Grausamkeit amerikanischer Außenpolitik zu spüren bekommen. Der Afghanistankrieg begann vor 42 Jahren, also im Jahr 1979, als die US-Regierung unter Präsident Jimmy Carter verdeckt islamische Dschihadisten unterstützte, um ein von der Sowjetunion gestütztes Regime zu bekämpfen. Bald trugen die von der CIA unterstützten Mudschaheddin dazu bei, eine sowjetische Invasion zu provozieren. Dadurch wurde die Sowjetunion in einen kräftezehrenden Konflikt verwickelt, während Afghanistan in eine 40 Jahre dauernde Abwärtsspirale aus Gewalt und Blutvergießen stürzte. Die US-Außenpolitik sorgte in der gesamten Region für wachsendes Chaos. Als Reaktion auf den Sturz des Schahs von Persien im Jahr 1979 (ein weiterer von den USA eingesetzter Diktator) stattete die US-Regierung unter Reagan den irakischen Diktator Saddam Hussein mit Waffen für seinen Krieg gegen die junge Islamische Republik Iran aus. Es kam zu massenhaftem Blutvergießen und US-gestützter chemischer Kriegsführung. Auf diese blutige Episode folgten Saddams Invasion in Kuwait und zwei von den USA angeführte Golfkriege (1990 und 2003).
Die jüngste Runde der afghanischen Tragödie begann im Jahr 2001. Kaum einen Monat nach den Terroranschlägen vom 11. September ordnete Präsident George W. Bush eine von den USA geführte Invasion an, um die islamischen Dschihadisten zu stürzen, die von den USA zuvor unterstützt worden waren.
Sein demokratischer Nachfolger, Präsident Barack Obama, setzte nicht nur den Krieg fort und entsandte noch mehr Truppen, sondern wies auch die CIA an, mit Saudi-Arabien zusammenzuarbeiten, um den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zu stürzen. Das führte zu einem brutalen, bis heute andauernden Bürgerkrieg in Syrien. Und als ob das noch nicht genug gewesen wäre, wies Obama die Nato an, den libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi zu stürzen, was wiederum zu einem Jahrzehnt der Instabilität in Libyen und seinen Nachbarländern führte (darunter auch in Mali, das durch den Zustrom an Kämpfern und Waffen aus Libyen destabilisiert wurde).
All diesen Fällen liegt nicht nur politisches Versagen, sondern auch die Überzeugung des außenpolitischen Establishments der USA zugrunde, wonach die Lösung jeder politischen Herausforderung in militärischer Intervention oder CIA-gestützter Destabilisierung bestehe…
... den vollständigen Kommentar lesen Sie >>> hier.
mehr...
Nobelpreisträger und NGOs fordern von Bundeskanzlerin Merkel Freigabe der Impfpatente
Friedensnobelpreisträger Professor Mohammad Yunus und 65 führende zivilgesellschaftliche Organisationen der People's Vaccine Alliance fordern anlässlich Bundeskanzlerin Merkels Treffen mit US-Präsident Biden an diesem Donnerstag die deutsche Bundesregierung auf, die Patente auf Covid-19-Impfstoffe auszusetzen. Die gesamte Woche über finden Protestaktionen in Deutschland und den USA statt, um den Druck auf Merkel zu erhöhen, sich der Biden-Administration anzuschließen und einen Verzicht auf Patente bei der Welthandelsorganisation (WTO) zu unterstützen.
Die People's Vaccine Alliance und Yunus weisen die Aussagen von Bundeskanzlerin Merkel zurück, dass die bestehenden Regelungen ausreichen würden, um Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen die Herstellung eigener Impfstoffe zu ermöglichen. Humanitäre Organisationen wie Brot für die Welt, Oxfam, Amnesty International, Avaaz, Action Aid, Global Justice Now und Public Citizen fordern eine Verzichtserklärung für den Schutz geistigen Eigentums. Der Verzicht auf geistiges Eigentum sei die einzige Möglichkeit, die Impfstoffproduktion weltweit auszuweiten, damit auch Menschen in ärmeren Ländern Zugang zu dem lebenswichtigen Schutz gegen COVID-19 haben, so die People's Vaccine Alliance.
Die tödliche dritte Covid-19-Welle, ausgelöst durch die Delta-Variante, bricht derzeit über die Welt herein. In Uganda, einem Land mit 45 Millionen Einwohnern sind bisher nur 4.000 Menschen vollständig geimpft worden. In Bangladesch führt die Delta-Variante zur Überlastung des Gesundheitssystems, die Zahl der Todesfälle steigt rapide an. Deutschland hingegen hat mit seinen 83 Millionen Einwohnern bereits 77 Millionen Dosen Impfstoff verabreicht, 24 Millionen mehr als der gesamte afrikanische Kontinent mit 1,4 Milliarden Einwohnern.
Mehr als 130 Länder haben eine Aussetzung der Patente für Covid-19-Impfstoffe und Behandlungen gefordert. Ursprünglich von Indien und Südafrika empfohlen, unterstützen auch die USA und die EU-Staaten Frankreich und Spanien diesen Schritt. Indem die deutsche Regierung auf der Aufrechterhaltung des Patentschutzes beharrt, setzt sie Menschenleben aufs Spiel.
Mit dem mRNA-Impfstoff hat BioNTech/Pfizer einen der wirksamsten Impfstoffe gegen COVID-19 entwickelt und damit einen Erfolg für die Menschheit erzielt. Doch gerade einmal 0,2 % der Dosen des Impfstoffs, den die deutsche Firma BioNTech in Zusammenarbeit mit Pfizer produziert hat, sind an Länder mit niedrigem Einkommen gegangen. Obwohl Studien zeigen, dass die Herstellung des Impfstoffs nur 1,17 US-Dollar kostet, wird der Impfstoff für durchschnittlich 18 US-Dollar pro Dosis verkauft, was ihn zu einem der teuersten COVID-19-Impfstoffe macht. BioNTech hat 556 Mio. € an öffentlicher Finanzierung erhalten. Gerade deshalb sollte sich die deutsche Regierung jetzt für die Freigabe der Patente einsetzen, um weltweit Leben zu retten.
mehr...
Die G20 muss jetzt handeln, um die Welt zu impfen
 |
Kulisse Venedigs mit Kreuzfahrerschiff
|
Ein Gastkommentar von Jeffrey D. Sachs und Juliana Bartels
Bei ihrem Treffen am 9. und 10. Juli in Venedig sollten die Finanzminister der G20 einen Plan verabschieden, um die Welt gegen COVID-19 zu immunisieren. Alle impfstoffproduzierenden Länder werden dort vertreten sein: die USA, Großbritannien, die Europäische Union, China, Russland und Indien. Gemeinsam produzieren diese Länder genügend Impfdosen, um den Impfprozess für die gesamte Welt bis Anfang 2022 abzuschließen. Doch fehlt noch immer ein Plan dafür.
Das bisherige globale Bemühen, den armen Ländern einen Impfschutz zu verschaffen – die sogenannte COVAX-Fazilität – bleibt bisher in katastrophaler Weise hinter den Erfordernissen zurück. Die impfstoffproduzierenden Länder haben ihre Produktion bisher dazu genutzt, ihre eigenen Bevölkerungen zu impfen – mit vielen Millionen an überschüssigen Dosen. Und die Impfstoffproduzenten haben geheime Absprachen mit verschiedenen Regierungen getroffen, um Impfstoffe bilateral zu verkaufen statt zu einem geringeren Preis durch COVAX.
Die Welt leidet unter der Selbstsüchtigkeit der impfstoffproduzierenden Länder, der Gier der Unternehmen und dem Zusammenbruch einer grundlegenden staatlichen Zusammenarbeit zwischen den wichtigen Weltregionen. Wir bezweifeln, dass sich Experten der US-Regierung je (und sei es nur per Zoom) mit ihren Kollegen in China und Russland getroffen haben, um eine globale Impfkampagne zu planen. Die USA waren mehr daran interessiert, Impfstoffe nach Taiwan zu verschiffen (vermutlich, um die Volksrepublik China bloßzustellen), als mit China zusammenzuarbeiten, um die gesamte Welt zu schützen.
Wissenschaftler warnen schon seit langem, dass Verzögerungen beim globalen Impfschutz verheerende Folgen für die gesamte Welt haben könnten, da sich neue Varianten herausbilden, die den bestehenden Impfstoffen ausweichen. Diese verhängnisvolle Entwicklung hat bereits begonnen. Israelische Wissenschaftler vermelden, dass der Pfizer/BioNTech-Impfstoff nur eine 64%ige Wirksamkeit gegenüber der Delta-Variante aufweist, verglichen mit 95% Wirksamkeit gegenüber dem ursprünglichen Virus (obwohl vier andere Studien eine deutlich höhere Wirksamkeit festgestellt haben)…
… den vollständigen Kommentar lesen Sie >>> hier.
mehr...
G20-Finanzminister: Mehr Schuldenerlass ist nötig

Damit sind diese Initiativen bislang nur ein sehr kleiner Tropfen auf einem sehr heißen Stein. Mehr als 100 Entwicklungs- und Schwellenländer sind gezwungen, dieses Jahr drastische Sparmaßnahmen zu ergreifen, um ihren Schuldendienst aufrechterhalten zu können (>>> Globaler Austeritätsarlarm). Darüber hinaus bleiben mehr als 40% der kritisch verschuldeten Mitteleinkommensländer weiterhin von der DSSI und dem Common Framework ausgeschlossen. Mehr als die Hälfte der begünstigten Mitteleinkommensländer nehmen nicht teil, aus Angst vor dem Verlust ihres Kapitalmarktzugangs. Dabei leben fast 80% der Menschen, die durch COVID-19 zusätzlich in extreme Armut gerutscht sind, in Mitteleinkommensländern.
Auch IWF-Chefin Kristalina Georgieva hatte kurz vor dem Venedig-Gipfel die geringen Fortschritte bei den bisherigen Schuldenerlassmaßnahmen beklagt. Noch beim Vorläufertreffen der G20-Finanzminister*innen im April sprach sich Bundesfinanzminister Scholz für echte Schuldenerlasse aus, Entwicklungsminister Müller folgte beim Gipfel der Außen- und Entwicklungsminister*innen in Matera letzte Woche. „Die Menschen in kritisch verschuldeten Ländern können nicht darauf warten, dass sich das Common Framework irgendwann bewährt hat“, so erlassjahr.de. Die Bundesregierung müsse Worten Taten folgen lassen und sich in Venedig für komplementäre Initiativen einsetzen. Konkrete Vorschläge dafür gebe es genug, so etwa von der Allianz der Kleinen Inselstaaten oder dem UN-Generalsekretär.
Hinweis: >>> W&E 02-03/2021: Italien und die G20-Präsidentschaft
mehr...